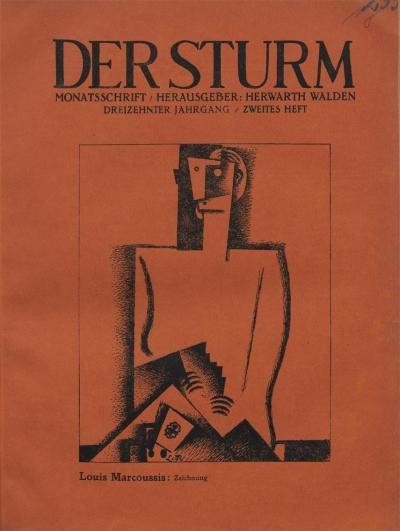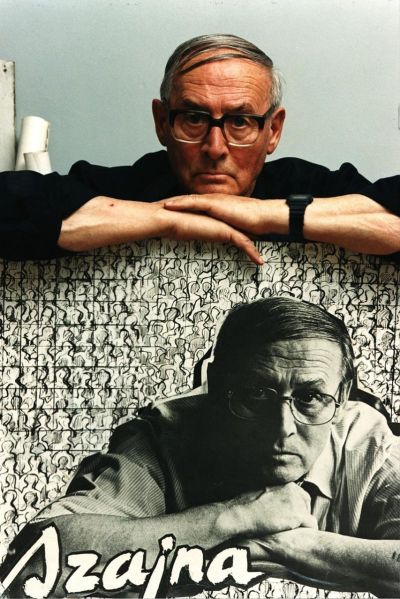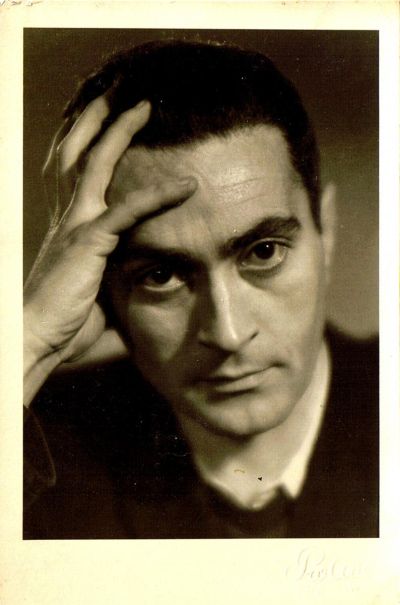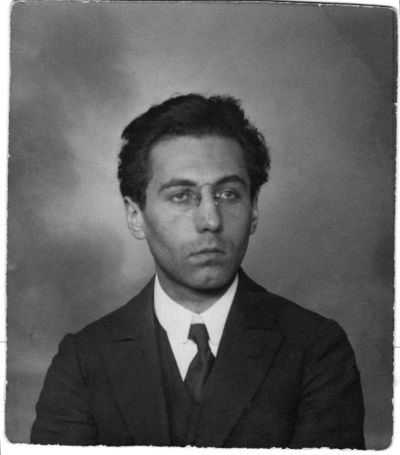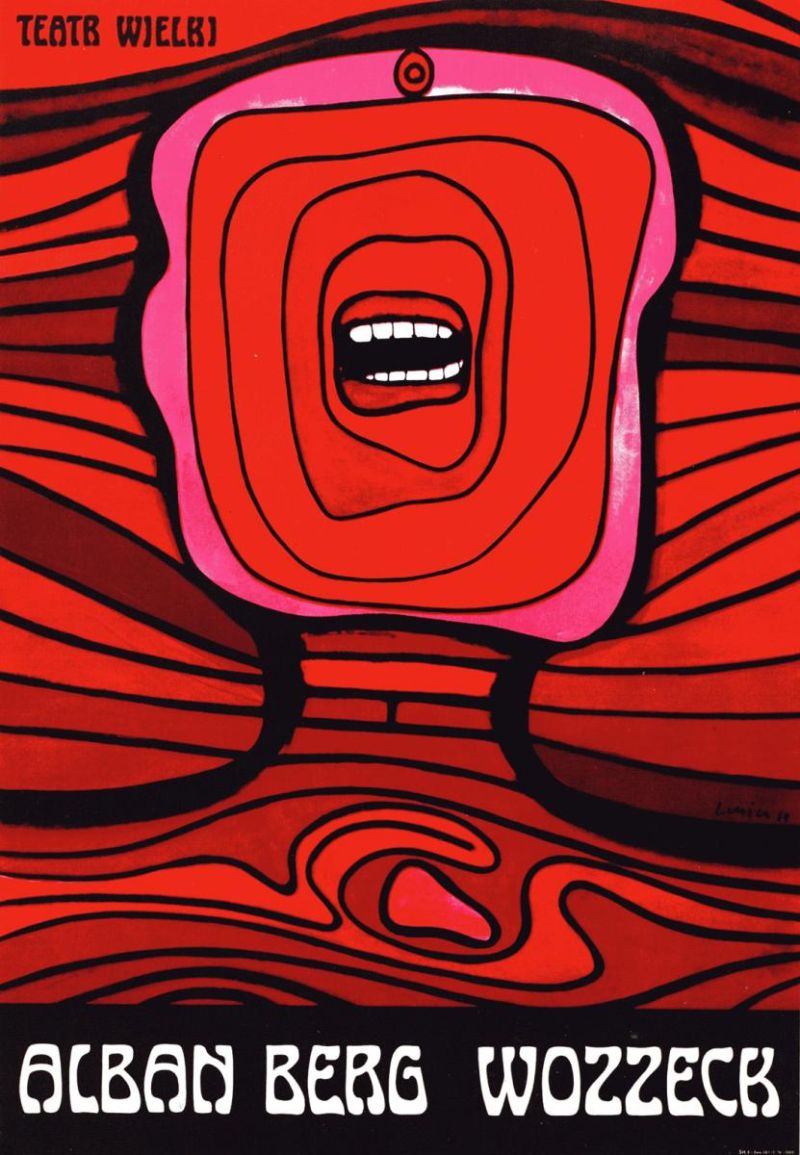Polnische Plakatkunst in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit
Mediathek Sorted





















![Abb. 22: Tomasz Sarnecki, Solidarność Abb. 22: Tomasz Sarnecki, Solidarność - W samo poludnie [Zwölf Uhr mittags], 4. Juni 1989](/sites/default/files/styles/width_100_tiles/public/assets/images/abb22.jpg?itok=ASCM67H8)

![Abb. 24: Jan Lenica, Wizyta starszej pani [Der Besuch der alten Dame] Abb. 24: Jan Lenica, Wizyta starszej pani [Der Besuch der alten Dame] - Ankündigung einer Theateraufführung](/sites/default/files/styles/width_100_tiles/public/assets/images/abb24.jpg?itok=a4ssK6p6)




Dass sich ab Mitte der 1950er Jahre der Kreise der Ausstellungsinitiatoren und -organisatoren zunehmend erweiterte und sich immer mehr ‚politisch unbedenkliche‘ Akteure im polnisch-westdeutschen Kulturaustausch engagierten, konnte daher in Bonn nur begrüßt werden. Galt es doch, der Quasi-Monopol-Stellung der Deutschen Gesellschaft für Kultur- und Wirtschaftsaustausch mit Polen auf diesem Gebiet etwas entgegenzusetzen.[27] So wurden Ausstellungen nicht nur genehmigt, nachdem man sich vergewissert hatte, dass die Gesellschaft nicht involviert war.[28] Es gab auch Bestrebungen seitens des Auswärtigen Amtes selbst, solche alternativen Veranstalter gezielt zu fördern, um ein Gegengewicht zur Deutschen Gesellschaft für Kultur- und Wirtschaftsaustausch mit Polen zu schaffen. Wohl oder übel in Kauf nehmen musste man dabei allerdings, dass diese Diversifizierung der Akteure und Netzwerke hinter den Ausstellungen auch den Behörden in Warschau sehr zupass kam. Denn auch dort war man schließlich bestrebt, im Kampf um die öffentliche Meinung Einflusssphären auszuweiten und ein möglichst breites bundesdeutsches Publikum mit polnischem Kulturexport zu erreichen.
Aber nicht nur politisch suspekte Veranstalter konnten polnische Plakatausstellungen in den 1950er und früheren 1960er Jahren zu einem Stein des Anstoßes werden lassen. In Zeiten, in denen man in Bonn von Neuer Ostpolitik und Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze noch weit entfernt war, machte auch die heikle Grenzfrage vor der polnischen Plakatkunst nicht halt. So wurde beispielsweise 1962 den Verantwortlichen einer Ausstellung polnischer Theaterplakate und Bühnenbildentwürfe in Schleswig nahegelegt, die Auswahl der Exponate noch einmal zu überdenken, nachdem bekannt geworden war, dass diese offenbar auch ein polnisches „Theaterleben in den Oder-Neiße-Gebieten“ dokumentieren würden.[29] In einem anderen Fall wollte das Auswärtige Amt der Deutschlandtournee des Pantomimentheaters Breslau nur unter der Bedingung zustimmen, dass auf den Plakaten und sonstigen Ankündigungen der Name der Stadt nicht vorkommt; kurzerhand schlug das Auswärtige Amt daher eine Umbenennung des Ensembles vor: statt „Pantomimentheater Breslau“ „Pantominentheater Henry Tomaszewski“ (nach dem Begründer und Leiter des Theaters Henry Tomaszewski, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Plakatkünstler). Dass einer der Aushänge dann doch mit dem Ensemblenamen „Pantomimentheater Breslau“ gedruckt wurde, sorgte für entsprechende Irritationen im Auswärtigen Amt.[30]
Wie diese Beispiele zeigen, konnten auch vermeintlich unpolitische und unverfängliche Kulturplakate politischen Zündstoff enthalten, wenn sie an politische Tabus rührten. Der wachsenden Popularität der polnischen Plakatkunst in der Bundesrepublik konnten diese behördlichen Bedenken, Vorbehalte und Vorsichtsmaßnahmen indes kaum etwas anhaben.
[27] Erhellend dafür sind verschiedene Dokumente in den Beständen des Politischen Archivs des Auswärtigen Amts in Berlin, bes. PAAA, B 95, Bd. 861.
[28] Z. B. eine Plakatausstellung des Badischen Kunstvereins Karlsruhe 1960, vgl. PAAA, B 95, Bd. 861, Schriftwechsel vom September 1960 zwischen Badischem Kunstverein, Ostabteilung (Ref. 705) und Kulturabteilung (Ref. 605) des Auswärtige Amts.
[29] Schreiben des Bundesministers für Gesamtdeutsche Fragen an den Kultusminister von Schleswig-Holstein, 2.3.1962, PAAA, B 95, Bd. 861.
[30] Vgl. den entsprechenden Schriftwechsel zwischen der Ostabteilung (Ref. 705) und der Kulturabteilung (Ref. 605) des Auswärtige Amts, Mai-Juli 1961, PAAA, B 95, Bd. 861.