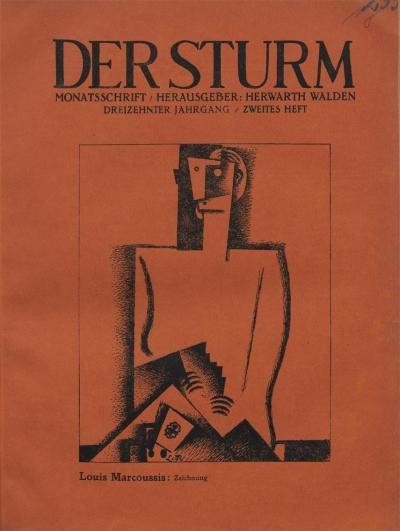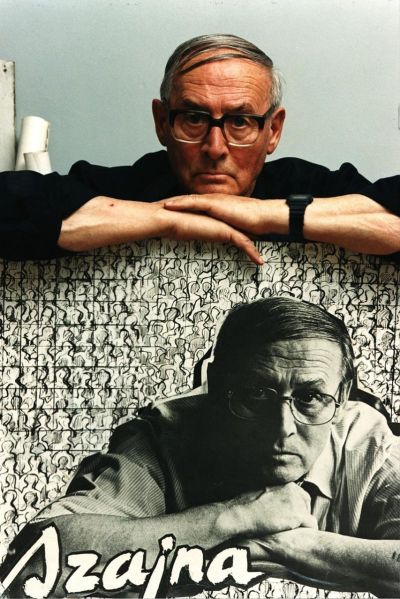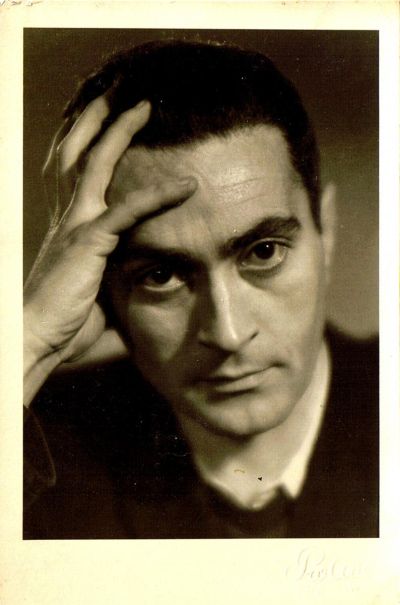Momente dessen, was wir Geschichte und Momente dessen, was wir Gedächtnis nennen
Mediathek Sorted




























Momente dessen, was wir Geschichte und Momente dessen, was wir Gedächtnis nennen
Das Vernichtungslager Sachsenhausen in den Fotografien von Marian Stefanowski
Leere, aufgeräumte, gepflegte Flächen gibt es im Übermaß. Ohne Menschen. Gewiss taucht gelegentlich eine anonyme Person oder eine Gruppe von Besuchern auf, festgehalten bei der Besichtigung eines Teils der Ausstellung, die sehr sachverständig zusammengestellt wurde und die − wie in allen Reiseführern nachzulesen ist − umfassende Informationen vermittelt. Doch dies alles stellt einen unkonkreten Hintergrund dar. Es sind Gäste aus einer anderen Welt, Fremde. Silhouetten oder Geisterschatten der Hauptverantwortlichen für das schreckliche Drama gibt es nicht. Diese Abwesenheit verblüfft und beunruhigt zugleich. Je länger ich von Bild zu Bild schreite, desto mehr bin ich der Überzeugung, dass diese Abwesenheit kein Zufall ist. Sie verdankt sich irgendeiner Absicht des Fotografen. Zumindest stellt sie irgendeine Fährte dar, auf die der Betrachter gelockt wird.
Ich war noch nie in Sachsenhausen und ich habe noch nie ein Konzentrationslager besucht. Ich verspürte kein Bedürfnis, mich dort aufzuhalten, nicht, weil mir die Existenz der KZs und ihre Geschichte unbedeutend wären. Ganz im Gegenteil. Für mich warfen Lagererlebnisse schon seit meiner Schulzeit − und ich gehöre der Generation an, die mit Büchern und Wissen über den letzten Weltkrieg reichlich gefüttert wurde − Fragen auf: nach dem Menschen, nach seiner Kultur und Geschichte, nach seinem Selbstverständnis, nach der moralischen und der gesellschaftlichen Ordnung, die der Mensch erzeugt, und zwar auf eine kompromisslose, verdichtete und sogar brutale Art und Weise. Das waren keine historischen, sondern rein anthropologische Fragen. Die Lagererlebnisse stellen eine beispiellose Grenzerfahrung dar, nicht die erste und nicht die einzige, jedoch extrem und zeitlich nah genug, um sie nicht einfach als historisches Fossil zu verdrängen, das den Seelenfrieden stört. Beim Lesen von Büchern und beim Anschauen von Filmen war mir all das bewusst. Was hätten die Besuche also Neues hinzufügen können, außer einem emotionalen Schauer auf den Pfaden des Verbrechens, an den Orten der Folter? Dies gilt umso mehr, als die Begegnungen mit der Vergangenheit an solchen Orten nicht unmittelbar sind: das Lager, das wir besuchen ist kein wirkliches Lager, unsere Situation entspricht keineswegs der Situation der Opfer. Auch nicht der Situation der Henker. Die Mühe kann man sich sparen.
War das meinerseits ein typischer Versuch, um meine Angst zu rationalisieren? Mit Sicherheit, ja. Marian Stefanowskis Fotografien vom Lager Sachsenhausen habe ich mir mit zunehmend großem Interesse angesehen. Möglicherweise deswegen, weil wir in diesem Fall mit einer Erkenntnis zu tun bekommen, die sukzessive vermittelt wird: die Spuren der empirisch unzugänglichen Vergangenheit nehmen wir durch den Blick, die Perspektive und die Auswahl eines Anderen wahr. Außer der Frage nach dem Gegenstand stellt sich auch die Frage nach dem Medium, das in diesem Fall die Rolle eines emotionalen Puffers übernimmt. In meinem Empfinden erwies sich Stefanowski als diskretes, transparentes Medium. Verborgen hinter seinem Thema hat er einen Zyklus vollkommen neutraler, distanzierter und kühler Fotos geschaffen, bei denen er auf aufgesetzte Expressionen und Kommentare verzichtet, die den Betrachter zu irgendetwas verleiten könnten. Seine fotografische Dokumentation ordnet sich dem besagten Ort vollkommen unter, ist fachkundig und systematisch. Sie bietet Gedächtnisorte, allgemeine Skizzen, einzelne Exponate, Gedenktafeln, sporadische Besuchergruppen und... sehr viel freie Fläche. Geordnete, saubere, gepflegte Fläche, die trotz alledem und trotz der Stille wie ehedem von Stacheldraht und Wachtürmen eingeschlossen ist. Eine aufgeräumte Bühne, die auf den nächsten Aufzug eines Dramas wartet? Für mich persönlich ist dies keine Metapher, eher ein gewollter Gedächtnismoment, in dem wir uns im Hier und Jetzt befinden. Die letzten Zeugen sterben aus, die generationsbedingte emotionale und kognitive Entfernung wächst. Schließlich weicht die Erinnerung an das Erlebte vor unseren Augen der nur noch konstruierten Erinnerung. Es liegt an uns, mit wem, womit und in welcher Konfiguration wir diesen menschenleeren Ort füllen. Es liegt an uns, den rätselhaften Besuchern, die, je nachdem wie groß die eigene Neugierde und wie stark die moralischen Grundsätze sind, dieser Erinnerung eine endgültige Gestalt verleihen, wenn sie mit dieser Flut an dramatischen Informationen konfrontiert und damit zugleich aus der Alltagsroutine herausgerissen werden. In seiner Konfrontation mit dem Problem überlässt Marian Stefanowski die letzte Entscheidung darüber dem Betrachter.
Warum kommen die Menschen hierher? Was suchen sie? Was nehmen sie mit nach Hause? Vielleicht eine prägende Erfahrung? Gelehrtes Wissen? Tief gehende Erlebnisse? Vielleicht ein Schuldgefühl? Ein Gefühl von Unrecht? Aber von welcher Schuld beziehungsweise von welchem Unrecht ist hier die Rede, wenn sie an den Schrecken der Vergangenheit an diesem Ort nicht selbst beteiligt waren? Nehmen sie überhaupt etwas Nachhaltiges mit? Das wissen wir nicht... Und trotzdem kommen sie hierher. Die Besucherstatistiken sind beeindruckend ebenso wie die Bewertungen auf den Reiseportalen. Auf Google Maps erreicht die durchschnittliche Bewertung 4,6 von 5 Sternchen, auf Trip Advisor 4,8 von 5, wobei die Zahl der Beurteilungen in die Tausende geht. Hinzu kommen hunderte von Kommentaren, aber auch sie liefern keine Antwort. Sie zeigen immer dieselben, sich wie ein Mantra wiederholende Phrasen: ein bewegendes, tief bewegendes, schmerzhaftes Erlebnis... Also doch eine harte emotionale Erfahrung.
Diese schwierigen Gefühle resultieren wahrscheinlich aus der Begegnung mit den Objekten der Ausstellung und mit den entsprechenden Erläuterungen der Ausstellungsführer, deren Kompetenz und profundes Wissen von den Besuchern hervorgehoben werden, die anschließend bruchlos zu den praktischen Hinweisen über angemessene Kleidung und Schuhwerk, Regenschirme und Proviant übergehen. Das Fazit ist grundsätzlich eine Übereinstimmung mit dem Ort, der einen Besuch wert ist, oder deutlicher gesagt, den man unbedingt gesehen haben muss. Aber warum? Um ein wenig von der schwierigen Verarbeitung zu erleben? Nein, es liegt mir fern, Erlebnisse und Emotionen zu ignorieren, aber… In der Fläche, die vom Objektiv des Fotografen erfasst wurde, ist dies nicht so offenbar. Wie ich bereits erwähnt habe, braucht der Betrachter eine gewisse Dosis eigenen Vorwissens und sehr viel Vorstellungskraft. Dabei kommt es manchmal zu dem banalen Resümee: „Dieser Ort zeigt, wie dünn die zivilisatorische Schicht über den primitiven Urinstinkte der Menschheit ist“. Dies klingt schon ein wenig besser, doch der Skeptiker in mir zweifelt immer noch: Sollte dies die Schlussfolgerung im Hinblick auf diesen Ort sein? Was wären dann die Konsequenzen? Verteidigung der Zivilisation? Fragt sich nur, was wir da verteidigen wollen? Mit welchen Mitteln? Gegen wen? Sicher gegen die Welt der Urinstinkte. Und wo sollte diese Welt sein? In uns oder in den anderen? Und wenn in den anderen, welches Kriterium der Andersartigkeit sollte hier gelten? Immerhin haben auch die Nazis die Zivilisation verteidigt, und zwar so, wie sie sie verstanden haben und zwar vor denen, die ihres Erachtens eine Gefahr für sie waren, indem sie Mittel eingesetzt haben, die sie für nötig hielten. In allen diesen drei Punkten – darüber besteht heute Konsens – gingen sie von falschen Annahmen aus, wobei sie sich in innere Widersprüche verfingen und sich in Verbrechen stürzten. Wo also liegen die Grenzen der zulässigen neuen Deutungen? Und wie sollten wir wissen, dass unsere Erkenntnisse weniger falsch wären und uns nicht zu Verbrechen oder zumindest zu Missbrauch verleiteten? Und zu guter Letzt: Nimmt das von uns konstruierte Gedächtnis an die Lagererfahrungen, an die Metonymie eines totalitären Systems mit all seinen Folgen, irgendeinen Einfluss darauf?
Das Gedächtnis, von dem ich schreibe, ist für mich ein dynamischer Komplex aus Vorstellungen über die Vergangenheit, dessen Funktion es ist, aktuelle und vergangene Erfahrungen als etwas Lebendiges und Bedeutsames zu organisieren. Ich schreibe auch über das konstruierte Gedächtnis, denn die Vorstellungen über die Vergangenheit, die auf Quellen und Berichten beruhen, gefiltert und ausgelegt unter Berücksichtigung früher erworbenen allgemeinen Wissens sowie des Wertesystems der Menschen, die sich damit befassen, sind nicht authentisch und können es übrigens auch gar nicht sein. Das Vernichtungslager Sachsenhausen als charakteristische Quelle historischer Erkenntnis kann durchaus zu diversen Interpretationen provozieren und sich in alternative Formen der Erinnerung fügen, die verschiedene Schlüsse, Haltungen und Sensibilitäten zulassen. Mangels zuverlässiger Daten kann ich die möglichen Beweggründe an dieser Stelle nur schematisch skizzieren.
So verfügen wir vor allem über das Stammesgedächtnis, das nach kollektiven verdinglichten Kategorien organisiert ist, die sich wiederum in einfache Oppositionen sowie Logiken symbolischer Identitäten gliedern.
Wir und Sie. Sie uns – wir Ihnen. Eine Matrix wechselseitiger Beziehungen und simpler Abstraktionen, die scheinbar in die Historie eingebettet ist, aus der sie ihre Legitimität schöpft, während sie tatsächlich in der Gestalt eines zeitlosen Mythos begegnet, der den Mechanismus weiterer Zitate, Wiederholungen und Rekonstruktionen treibt. Eine nützliche Sache, vor allem, um die Identität und den Zusammenhalt der eigenen Gruppe aufzubauen, allerdings auf Kosten der Gesamtperspektive. Wir Ihnen – Sie uns. Eine ständig offen bleibende Rechnung − in der dritten, vierten und in jeder weiteren Generation. Sie die Bösen – wir die Guten. Diese Form des Gedächtnisses hat eine lange Tradition, ist eigentlich schon seit jeher präsent, also auch dann, als das Gedächtnis die Erfahrung der Schrecken des Totalitarismus im 20. Jahrhundert betraf. Je weiter wir uns von den Geschehnissen entfernen, um so mehr nimmt dieses Gedächtnis im offiziellen Narrativ, das gerne bedient wird, Oberhand. Darin steckt eine gewisse Zwangsläufigkeit. Die Generation der unmittelbaren Zeugen wurde von der Sensibilisierung für Kriegserfahrungen als tragischer und traumatischer Untergang der Menschheit, von ihrer Selbstwahrnehmung sowie von den Mythen und Illusionen über den Fortschritt, die Menschlichkeit und die moralische Entwicklung stark geprägt. Das Grauen des Krieges war für jeden dieser Menschen eine Niederlage und eine Verpflichtung. Die über die Grenzen der Stammesidentitäten hinausgehende Perspektive ließ sich nicht mehr so leicht leugnen. Heute, wo fast alle Zeugen verstorben sind und die Erinnerung weniger das Produkt eigener Erfahrungen als ein intellektuelles Konstrukt ist, hat sich das Klima geändert. Militärische Motive beherrschen die Litanei offiziell geförderter Muster. Kämpfen um des Kämpfens Willen, völlig aus dem militärischen, politischen und gesellschaftlichen Kontext gerissen, wird zur erhabensten Manifestation von Patriotismus, und wieder ist es süß, für das Vaterland zu sterben. Der Krieg als solcher, oder präziser gesagt, kollektive organisierte Gewalt ist kein Ausdruck tragischen Rückschritts der Menschheit mehr, sondern wird erneut zu einem öffentlich diskutierten, legitimierten Instrument von Politik sowie zur Betreibung gemeinschaftlicher Interessen, die moralisch natürlich gerechtfertigt sind. Aber gibt es überhaupt andere? Und zeigt sich diese Akzentverschiebung nicht deutlich und symbolisch, wenn der jetzige Direktor des Danziger Museums des Zweiten Weltkriegs (Muzeum II Wojny Światowej) in der Debatte um eine neue Ausstellungsformel fordert, die „positiven Aspekte des Krieges“ in das didaktische Programm aufzunehmen? Signum temporis.
Dieses Narrativ enthält selbstverständlich nicht die positiven Aspekte der Konzentrationslager oder der Lagererlebnisse, doch angesichts des scheinbaren Feindes werden Letztere oft und gerne instrumentalisiert, und zwar im Sinne von Ad-hoc-Politik sowie um die Disziplin und gesellschaftliche Identität aufzubauen; das Narrativ wird kanalisiert und in die Stammesschemata eingepasst. Und nun lese ich die Berichte regierungsnaher Medien über den Besuch des amtierenden Präsidenten unseres Landes in Sachsenhausen, wo er Blumen an der Gedenktafel für polnische Gelehrte niederlegte, die hier im Rahmen der sogenannten „Sonderaktion Krakau“ inhaftiert worden waren. Sofern man den Zusammenfassungen Glauben schenken darf, ging das Narrativ der zu diesem Anlass gehaltenen Rede nicht über die erwähnten nationalen Kategorien hinaus.
Die Deutschen als Verfolger – wir als Opfer. Weitere Kategorien zur Beschreibung fehlen. Damit will ich nicht sagen, dass dieses Bild nicht der Wirklichkeit entspricht. Vielmehr geht es mir darum, dass die nur darauf reduzierte Erfahrung Sachsenhausen zu einer nur noch partiellen, fehlerhaften Erinnerung wird, während die nationalen Verallgemeinerungen, die nichts weiter erklären noch etwas präzisieren, ein kognitiv zweifelhaftes Bild der Wirklichkeit erzeugen. Dies ist besonders im Kontext des Ortes spürbar, an dem solche Reden gehalten werden: die ersten Gefangenen des nationalsozialistischen Regimes, die der kollektiven Stigmatisierung, der Ausgrenzung und Repressalien ausgesetzt waren, waren schließlich deutscher Nationalität. Innere Fremde, die eine Gefahr für die Chimäre der nationalen Einheit und der nationalen Ziele waren und die beispielhaft für spätere Kriege gegen äußere Fremde litten. Diesen Mechanismus zu verstehen und die Unangemessenheit homogener, nationaler Verallgemeinerungen aufzuzeigen, ist jedoch zweitrangig. Ja, man könnte sogar sagen, dass das Narrativ des Präsidenten in dieser Hinsicht paradoxerweise und sicher unbewusst mit der offiziellen Position des NS-Regimes konform geht, das „Andersartige“ beziehungsweise „asoziale Elemente“ aus dem „wahren“ Deutschtum ausgeschlossen hat. Das ist die Logik und das ist der Preis der Mythen von Stammesidentitäten sowie der um sie herum organisierten Stammesgedächtnisse.
Einen Gegenpol zu diesen Auffassungen bildet das Gedächtnis, das man universell nennen könnte, das all jene kollektiven Kategorien, die in der oben skizzierten Beschreibung so wichtig sind, bewusst ignoriert, zumindest aber in den Hintergrund drängt. Die rein personale Situation, die hier auf ein durch den Akt der Gewalt geprägtes binäres System von Verfolger und Opfer reduziert wird, ist ein Modell, in dem sich die konkrete Opposition zwangsläufig aus der Zugehörigkeit zur jeweiligen kollektiven Gruppe ergibt bzw. jedenfalls ergeben kann. Die Kategorien selbst sind akzidentell und resultieren aus den konkreten historischen Umständen. Die Erforschung dieser Umstände ist sowohl im Hinblick auf die Erklärung der Ereignisse als auch auf die Deutung, sofern sie überhaupt möglich ist, der großen Mechanik, die in die Tragödie führt, zu priorisieren. Dabei hat man mit Variablen zu tun, die das Verständnis der Umstände als solche nicht erlauben. In eine bedrückende Lage kann jeder geraten, und zwar ungeachtet seiner gesellschaftlichen Rolle, des Ortes und der Zeit. Dieses generelle Moment hat eine wichtige moralische und kognitive Dimension. In dieser Variante des Erinnerns ist es gewiss leichter, die Opferperspektive einzunehmen. Das ist intuitiv ein moralischer oder sogar ein emotionaler Reflex. Die vorherrschenden Formen dieser Art von Gedächtnis konzentrieren sich daher auf die Opfer, auf die Enthüllung, die Bezeichnung und die Rekonstruktion der Erinnerung an sie, auf den rituellen Respekt für sie und auf den Versuch, jede Lebenslinie, die durch die Verfolgung erschüttert wurde, zu rekonstruieren. Die Pietät derer, die sich dieser Rekonstruktion annehmen, ist schon an sich ethisch wertvoll, weil edel in der Gesinnung. Ist sie von Empathie und Mitgefühl erfüllt, die wiederum zu einer Sensibilisierung für alle mehr oder weniger drastischen Manifestationen von Repression, Erniedrigung und Unterdrückung führen, umso besser.
Wenn wir aber nicht nur auf die geschehene Unterdrückung reagieren, sondern auch ihre Gefahren und ihre verschiedenen Erscheinungsformen richtig erkennen wollen, erscheint es mir notwendig, auch die Erinnerung an die Täter und sogar das Gedächtnis der Täter selbst wachzuhalten.
Wer waren sie? Was hat sie zu ihren Taten motiviert? Was wollten sie erreichen? Mit welchem Wertesystem wollten sie ihre Taten rationalisieren? Ein solches Gedächtnis, das nichts entschuldigt, sondern sich nur nicht mit ebenso plausiblen wie einfachen moralischen Urteilen abfinden will, und statt dessen bemüht ist, in den Tätern Menschen wie wir zu sehen, die denselben psycho-sozialen Mechanismen unterliegen, kann inneren Widerstand provozieren. Es bietet aber die Gelegenheit, das Geschehene zu verstehen und so eine Art Aufmerksamkeit, also gewissermaßen einen kognitiven und moralischen Filter in uns zu setzen, der es uns erlaubt, die Gefahren in unserer eigenen, vertrauten und allzu offensichtlichen Welt wirklich zu erkennen. Diese Überzeugung ergibt sich daraus, dass für die Entstehung eines Unterdrückungssystems, das sich in der Opposition von Opfer und Täter zeigt, die Haltung und die Handlung des Täters von oberster, ja, von konstitutiver Bedeutung sind. In der Regel wählt ja das Opfer seine Rolle nicht selbst: Das Opfer wird ausgewählt. Dass also der Rahmen der Situation von einem anderen bestimmt wird, engt den Handlungsspielraum des Opfers dramatisch ein. Dabei denke ich hier nicht mal an die Lagersadisten, die ihre angewandte Gewalt einfach nur genießen. Sie sind das letzte Glied in einer langen Kette. Mich interessiert viel mehr die chronologisch und vor allem die logisch frühere Phase: Welche systematischen Vorstellungen im Hinblick auf die Organisation einer Gesellschaft, welche Menschenbilder, welche begrifflichen Raster waren in der Lage, diesen Punkt herbeizuführen? Welche Begründungen, welche Rationalisierungen, welche Abwehrmechanismen? Gelten für manche nicht Konzepte zum Schutz der Gesellschaft vor Gefahren für ihren kulturellen, ethnischen und religiösen Zusammenhalt oder für ihr Identitätskonstrukt immer noch als scheinbar rational?! Ebenso Forderungen, bei asozialen Elementen, die gegen allgemeine Normen verstoßen, korrigierend zu intervenieren? Oder die wie auch immer definierten Ränder der Gesellschaft zu resozialisieren? Und was ist mit repressiven Maßnahmen als Erziehungsmethode auf jeder gesellschaftlichen Ebene? Wie verhält es sich mit Hierarchien und mit der Disziplin als unbestrittene Werte und Bindeglieder menschlicher Gruppen? Fällt die Instrumentalisierung Dritter als menschliche Ressource zur Durchsetzung von Werten, die eine Gruppe favorisiert, hier heraus? Oder die Unterordnung des Rechts des Einzelnen auf selbstbestimmtes Leben, angefangen mit der Definition der zulässigen Lebensentscheidungen bis hin zum buchstäblichen Recht aufs Überleben, das von der Erfüllung willkürlich festgelegter Voraussetzungen abhängig sein soll? All diese klischeehaften Konzepte, diese banalen Manifestationen alltäglicher Dominanz und Gewalt, lassen sich bis zu einem gewissen Grad noch verteidigen. Zumindest finden sie ihre Verteidiger. Sie müssen nicht in totalitären Horror münden, doch sie können es. Mehr noch: sie sind der Humus, aus dem der Horror entsteht. Wo also ist die Grenze?
Eine so verstandene Erinnerung an die Täter geht über das explizite Narrativ der Lagererfahrung hinaus, wobei sie die Einmaligkeit und die Schrecken dieser Erfahrung keineswegs mindert. Sie gibt Hinweise auf etwas Anderes, was die Voraussetzung betrifft. Auf etwas, was man auch in sich selber sowie in den Strukturen der eigenen Welt aufsuchen kann und sollte. Dabei scheint es so zu sein, dass nur die Verknüpfung empathischer Erinnerung an das Opfer mit der kognitiven Erinnerung an den Täter beziehungsweise an die gesellschaftlichen und mentalen Strukturen, die ihn bedingen, eine wirksame formative Erkenntnis ermöglicht, die sich so sehr von der Stammesperspektive, auch wenn diese auf ihre Art ebenfalls wirksam und formativ ist, unterscheidet.
Kann es aber bei alledem sein, dass das Gedächtnis mit der Zeit und mit dem Erwachsenwerden der Urenkel der Zeitzeugen versteinert und museal-gelehrte Formen annimmt, die keine persönlichen Bezüge mehr besitzen? Eine Form, die nicht mehr beschäftigt als die blutigen Exzesse assyrischen Monarchen, die Grausamkeiten Tamerlans oder die Organisationsstruktur der Zuchthäuser auf den Latifundien der Römischen Republik? Sachsenhausen? Ja, das ist der Ort, den Reiseführer als „interessanten Ort in der Nähe Berlins“ bezeichnen, den sie für einen Tagesausflug empfehlen. Richtig ist wohl, dass dieser Ort drastische, blutige Geschichten dokumentiert und starke Emotionen weckt, die einfache Reflexionen über die Schattenseiten der menschlichen Natur auslösen, doch insgesamt ist er zu seltsam und dem Alltag zu sehr entrückt, um solche Gedanken als eine sinnvolle Erzählung über sich selbst und über die eigene Welt anerkennen zu können. Vielleicht sind die schablonenhaften Schlussfolgerungen der Nutzer und Rezensenten der Reiseportale, der hastigen Konsumenten touristischer Attraktionen oder derer, die große Gefühle erleben wollen, Beweise dafür? Es lohnt sich, für bequemes Schuhwerk und für einen Regenschirm zu sorgen, falls es regnen sollte, und sich gleich die Liste der empfohlenen Restaurants in der Nähe anzuschauen, da der Mensch nach einer mehrstündigen Besichtigung bekanntlich hungrig wird...
Dies alles verkörpert die Vision einer jugendlichen Rebellion eines meiner Schulfreunde, der unter der Last der Lagerliteratur auf den Lektürelisten zu bedenken gab: sie warnen uns, indem wir uns an diese Schrecken erinnern. Aber wäre es nicht vielleicht besser, sie zu vergessen? Und wenn Menschen künftig noch einmal in den Sinn kommen sollte, ähnliche Dinge zu tun, werden sie möglicherweise sie als zu innovativ, als zu avantgardistisch empfinden? Damals war die Frage nicht ganz ohne Sinn, aber nach so vielen Jahren, gerade heute, im Kontext der fotografischen Erzählung von Marian Stefanowski, sehe ich mich gezwungen, sie zu verneinen. Sowohl in der Erfindung immer neuer Formen der Versklavung, der Erniedrigung, der Ausbeutung und der Tötung als auch in der systematischen Rechtfertigung solcher Dinge zeichnet sich die Menschheit durch einen Erfindungsreichtum aus, den keine Tradition beschränkt, und wenn er doch einmal behindert wird, dann sind es meist technologische Hürden. Aus diesem Grund und nicht in Folge moralischen Verfalls, hat die Intensität des Schreckens in der Neuzeit ihren Höhepunkt erreicht. Auch wenn es keine Belege dafür gibt, dass frühere kollektive Erfahrungen eine Gemeinschaft jemals davon abgehalten haben, Verbrechen zu begehen, plädiere ich ganz entschieden für eine wachsame, sensible, empathische und engagierte Pflege der Erinnerung. Auf etwas muss man doch setzen. Das ist für jeden von uns letztlich eine moralische Entscheidung.
Zurück zu den Fotografien von Marian Stefanowski. Zu der leeren, beängstigend sauberen, geordneten „weiten Fläche”, in der sporadisch kleine Gruppen von Menschen zu sehen sind, die in keine Verbrechen und kein Leid verstrickt sind und die keiner existenziellen Extremerfahrung der Geister der Vergangenheit unterworfen sind, sondern die in unsere Zeit gehören, während sie zwischen den grausamen Artefakten, den Splittern der Geschichte und der sich vor ihnen öffnenden freien Fläche wie verloren wirken. Die auf der Suche nach ihrem eigenen Weg und ihrer eigenen Antwort sind. Fragt sich nur, wie fällt sie aus?
Das kühle und distanzierte Auge des Fotografen raunt uns auch diesmal keine verbindlichen Lösungen zu.
Und so kommen wir zu dem Punkt, an dem die Erfahrung des Lagers Sachsenhausen dank Marian Stefanowskis Kamera auch zu meiner eigenen Erfahrung wurde, einer Erfahrung, die mir vor allem als eine offene, sich ständig wiederholende Frage begegnet: nach einer Idee, nach den Vorstellungen und nach den psychogesellschaftlichen Mechanismen, die sowohl die kollektive als auch die individuelle Gewalt in ihren unzähligen Formen und Varianten begründet. Eine Frage nach der immerwährenden Präsenz dieser Ideen in allen möglichen gesellschaftlichen Systemen, mitunter verdeckt, diskret und banal, aber auch vertraut und rationalisiert und nur selten beeinflusst von einer Tragödie, die durch bestimmte Umstände offen ausbricht und die Öffentlichkeit erschüttert. In diesem Sinne stellt sich keine Frage nach dem Nazismus als solchen mehr, obwohl das Ausmaß der Gräueltaten, deren Quelle und direkter Verursacher er war, weder überschätzt noch vergessen werden kann. Der Nationalsozialismus mit seinem System der Stigmatisierung, der Isolierung, der Entmenschlichung und der Vernichtung offenbart auf mustergültige Art und Weise − schließlich war Sachsenhausen das Paradeobjekt des Systems, als Muster eines Musters konzipiert und entworfen − als eine auf die Spitze getriebene Konsequenz einer in menschlichen Gesellschaften dauerpräsenten Denkweise sowie der entsprechenden Kategorien und Vorstellungen. Alles ist eine Frage der Umstände, der Möglichkeiten und der Dimension. Vielleicht werden wir auch nicht lange warten müssen, bis es erneut zu Stacheldraht und Wachtürmen kommt? Und, global gesehen: sind sie wirklich verschwunden? Das wäre wohl zu viel an moralischem Luxus.
Sollte es aber jemals eine Art private Erinnerungsform an diesen Ort, mein gewissermaßen privates Museum der Unschuld geben − denn wer bin ich schon, dass ich für andere entscheide? − würde sie genauso sein.
Betrachten wir also unsere gesellschaftlichen Gewissheiten und Strukturen skeptisch, fragen wir und hinterfragen wir. Fragen als solche münden selten in Mord. Anders als die unerschütterlich sicheren Antworten, die keinen Raum für Zweifel lassen.
Krzysztof Dudziak, Juni 2020
Bearbeitung: Magda Potorska